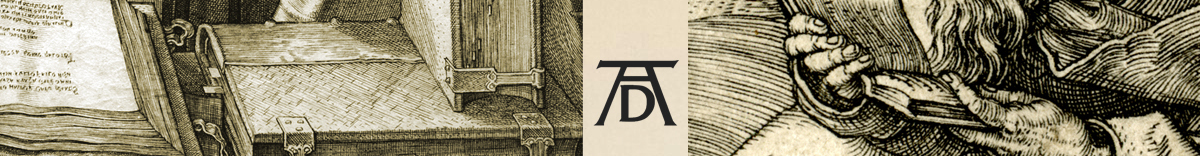Bildnisdiptychon des Elternpaars Albrecht d. Ä. und Barbara Dürer, 114345
Willibald Imhoff kaufte die Porträts von Albrecht Dürers Eltern, Albrecht d. J. und Barbara Dürer, für 20 fl von Ursula Dürer, geb. Hirnhofer, Albrechts Schwägerin. In Imhoffs Inventar von 1573/74 sind unter Nr. 19 beide Bilder gelistet; diese Zahl findet sich in roter Farbe auch heute noch auf den Tafelrückseiten weswegen schon Brand und Anzelewsky davon ausgingen, dass die beiden heute getrennt in Florenz und Nürnberg aufbewahrten Tafeln einst ein Diptychon bildeten. Da Farbzusammensetzung und Malerei der Rückseiten übereinstimmen muss es einst eine Tafel gewesen sein (Bartl 1999, S. 26). Geteilt wurde das Ditpychon wohl zwischen 1588, als es zuletzt gemeinsam im Imhoff’schen Inventar erscheint, und 1604, als Carel van Mander in Nürnberg nur noch das Bild der Mutter gesehen hat.
S. 117, Nr. 2-4
S. 5