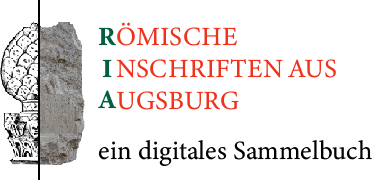Main page content
Der auf einer Platte mit profiliertem Rahmen angebrachte Text ist wenigstens zur Hälfte links verloren.
[In h(onorem) ] d(omus) d(ivinae) / [...][M]atutino / [...]us[---]us (männlich, Dekurionenstand) decur(io) Decurio (Stadtrat) m(unicipii) / [ Ael(iae) Aug(ustae) [...]] porcarius(Handels-)Güter Händler / [...] aedemTempel / [vetustate conla]bsam *sic a solo / [sua pecunia res]tituit l(ibens) l(aetus) m(erito)
Zur Ehre des göttlichen Hauses (errichtete) dem Merkur (?) Matutinus ---us, der Dekurio des municipium Aelium Augusta und Händler mit Schweinefleisch ---, den Tempel, der infolge seines Alters völlig verfallen war, von Grund auf neu aus seinem eigenen Vermögen bereitwillig, froh und nach Verdienst.
Auf der verlorenen Hälfte standen pro Zeile 12-15 Buchstaben.
In Z. 1 noch der Rand des Bogens eines D zu erkennen, d(omus)] d(ivinae). Z. 2: [Iano? Patri? M]atutino? Vgl. Hor. sat. 2,6,20. Oder [Mercurio? M]atutino? Z. 4: negotiator] porcarius.
Kuhoff: Der wohlhabende Decurio und Händler der Stadt zeigte wie einige Kollegen seine Munifizenz gegenüber Stadt. Seine Tätigkeit als porcarius ist im süddeutschem Raum sonst nicht überliefert, obwohl der Handel mit Fleisch nicht selten gewesen sein kann. Wahrscheinlich handelte es sich um einen gut verdienenden Großkaufmann, der die nötigen Mittel zur Wiederherstellung des Tempels überhaupt aufbringen konnte. Vermutlich verweist der Beiname 'Matutinus' nicht auf Mercurius (https://sempub.ub.uni-heidelberg.de/ria/de/wisski/navigate/1618/view), sondern auf Ianus.
Datierung: Die Anfangsformel IN H D D, die Symmetrie des Textes, der regelmäßige Duktus, und die fehlenden Ligaturen verweisen auf die severische oder etwas spätere Zeit.
(EDH, JW)