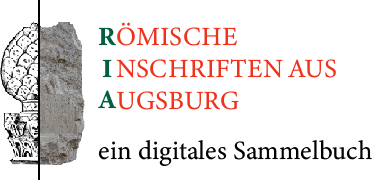Main page content
Mittelteil eines Grabaltars. Aufsatz und Basis wurden neuzeitlich ergänzt. Auf den Nebenseiten sind Pinienzapfen zu sehen.
Der Altar, der zuvor für einen Grabstein eines Pfarrers gehalten wurde, wurde 1818 in einer Kirchhofmauer in Bergheim entdeckt, gereinigt und mit herauswärts gekehrter Inschrift neu eingesetzt. 1822 wurde er ins Museum gebracht.
D(is) M(anibus) Di Manes / M(arco) Buccinio / TacitoM. Buccinius Tacitus (männlich) / vixit an(nos) LXXX / p(atronus) et h(eres) f(aciendum) c(uravit) / et Iul(io) Ma/rinoIulius Marinus (männlich)
Den Totengöttern und dem Marcus Buccinius Tacitus, der 80 Jahre lebte, ließ sein Patron und Erbe (das Grabmal) errichten und dem Iulius Marinus.
IBR, CIL: Z. 6/7 offenbar nachträglich hinzugefügt. Hedera in Z. 7.
Kakoschke: 'Buccinius' ist ein einheimisches Pseudo-Gentilnomen, abgeleitet vom keltischen Cognomen Buccus. Der erst genannte Verstorbene kam sicherlich aus Raetien oder dem benachbarten keltischen Gebiet. Das Cognomen des zweiten Verstorbenen, Marinus, kommt im östlichen Mittelmeerraum häufiger vor, jedoch reicht das vermutlich nicht, um seine Herkunft dort zu verorten. Laut Kakoschke war er eher auch ein Einheimischer.
(EDH, JW)